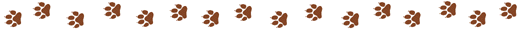Scheue Wölfe, aggressive Hunde
Menschen fürchten die Rückkehr des wilden
Isegrim,
doch zahme Vierbeiner richten weitaus mehr Schaden
an
Von Volker Hohlfeld
Streng abgeschirmt vor neugierigen Besuchern und Fotografen wird der am Donnerstag bei Eisenhüttenstadt gefangene Wolf die ersten Tage im Tierpark Eberswalde verbringen. Der 45 Kilogramm schwere Wolfsrüde hat die erste Nacht gut überstanden. Tierparkdirektor Bernd Hensch: «Aus der Narkose ist er gut aufgewacht. Auch hat er in der ersten Nacht Futter angenommen. Die Verletzung am rechten Hinterlauf ist gut verheilt. Ich vermute, dass der Wolf mit dem Hinterlauf in ein Fangeisen geriet und so ein Teil des Laufes abgetrennt wurde. Um sich zu befreien, hat er sich möglicherweise die Pfote selbst abgebissen.» Mit großer Wahrscheinlichkeit ist das Tier aus Polen über die Oder gekommen. In Polen stellt man dem Wolf auch mit Fangeisen und Fallen nach.
Seit 1945 sind in Deutschland 25 Wölfe abgeschossen worden. Je einen Wolf erlegten Jäger in der Nähe von Bonn und München. Der weitaus größte Teil aber wurde im Land Brandenburg erlegt. Fast jedes Jahr tauchen einzelne Tiere von Polen kommend in Brandenburg auf. Bis 1990 wurden diese «illegalen Grenzgänger» abgeschossen. Jetzt stehen die grauen Jäger unter Schutz.
Den letzten Wolf in Brandenburg schoß ein Waidmann 1994 bei Gardewitz in der Uckermark. Er verwechselte ihn mit einem Wild jagenden Hund.
Hensch erinnert sich: «In mehreren russischen Kasernen gab es Wolfsgehege. Ich selbst habe Wölfe in einer Kaserne in Finowfurt gesehen. Als die Soldaten abzogen, machten sie einfach die Türen auf. 1991 bot mir ein russischer Offizier drei Wölfe zum Kauf an. Durch die Gehegehaltung hatten diese Tiere die natürliche Furcht vor Menschen vollkommen verloren.»
Hensch ist fasziniert vom Stolz und der Ruhe, die der Wolfsrüde ausstrahlt. «Wir werden versuchen, ihn in unser Rudel, das zur Zeit aus einem Rüden und drei Weibchen besteht, einzubeziehen. Dazu werden wir ihn nach der Eingewöhnungsphase in ein Nachbargatter des Rudels setzen. Der spannende Augenblick kommt dann, wenn sich beide Rüden gegenüberstehen. Kommt es zu einer Abklärung der Rangordnung, wird er das Rudel verstärken. Sollte das aber nicht möglich sein, bringen wir ihn artgerecht in einem anderen Tierpark unter." Zuvor wird er zur Behandlung noch mal narkotisiert.
(Quelle: Berliner Morgenzeitung v. 29.1.2000)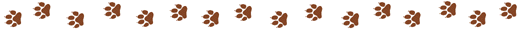
Die Leute benachrichtigten die Untere Jagdbehörde und die Experten des Landesumweltamtes, die das Tier eindeutig als Wolf identifizierten.
Der Wolfsrüde ist verletzt: Sein rechter Hinterlauf ist am Sprunggelenk abgetrennt, er «humpelt» auf drei Beinen. Im Beisein der Experten - sie kamen bis auf 20 Meter an das Tier heran - wurde der Wolf von einem Fürstenwalder Tierarzt mit einem Narkosegewehr betäubt und anschließend in den Zoo von Eberswalde (Barnim) gebracht.
Nach Angaben des Zoos kann das Tier jedoch erst ab Mitte nächster Woche besichtigt werden.
Matthias Freude, Präsident des Landesumweltamtes: «Zum Schutz des verletzten Tieres und der Haustiere der Region mussten wir den Wolf fangen. Verletzte Wölfe bevorzugen leichte Beute, also Haustiere. Sie sind auch durch den Verkehr besonders stark gefährdet.» Der 42 Kilogramm schwere Wolfsrüde hat die typisch graue Fellfärbung und einen ockerbraunen Überflug.
In Polen existieren seit langem Wolfspopulationen, von denen vor allem junge Tiere auf uralten Wolfspfaden in Richtung Westen wandern. In den dünn besiedelten Landesteilen finden sie gute Lebensbedingungen.
Wölfe sind in Brandenburg ganzjährig geschützt.
(Quelle: Berliner Morgenzeitung v. 27.1.2000)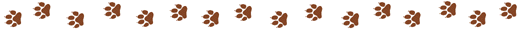
Wölfe in Brandenburgs Wäldern gesichtet
Der Morgen war kalt. Die klare Dezemberluft schnitt beißend in die Wangen von Dietrich Bennewitz, 70. Aber der Förster im Ruhestand aus Reichenwalde harrte geduldig auf einem Hochsitz in der Nähe des Wotzensees aus. Seine Geduld wurde belohnt.
"Ich hörte zwei Mufflons - und dann sah ich ihn plötzlich, den Wolf, "erinnert er sich, "das Tier schnupperte an der Fährte der Wildschafe." Kurzer Blickkontakt. Zwischen Mensch und Wolf lagen etwa 80 Meter Luftlinie. Der graue Schemen reckte seine Schnauze in die Luft, nahm Witterung vom Menschen - und hetzte in großen Sätzen davon. Wölfe. Die grauen, mythenbeladenen Wanderer mit den gelben Augen sind wieder da. Sie schnüren durch Brandenburg, bis vor die Tore Berlins. Noch einer bemerkte das Tier, Revierförster Ulrich Pape:. "Ich muss den Wolf wohl im Uferschilf aufgeschreckt haben, als ich mit meinem Hund am Wotzensee unterwegs war." Allerdings entdeckte er nur die Pfotenabdrücke des Tieres im Schnee, verfolgte sie bis zum Hochsitz.
Die Fährte des Wolfes. Wer sie zurückverfolgt gelangt über die Oder, gelangt bis in die dichten Wälder Polens. Hier leben noch rund 1000 Tiere, von hier aus traben sie nach Brandenburg. Die grauen Schemen folgen uralten Routen. Wegen, die sich dem Instinkt über Jahrhunderte einprägten. Wölfe. Im Laufe der Geschichte oft als reißende Bestien gestempelt. In Märchen wie Rotkäppchen zum menschenfressenden Scheusal stilisiert. Die Legende machte die scheuen, ängstlichen Tiere zu Opfern sinnloser Schlächterei - auch in Brandenburg. Isegrim galt hier als ausgestorben, für lange Zeit der letzte wurde 1846 getötet: Drei Jäger, drei Schüsse drei Treffer - und das Ende seiner Art. Von diesem Drama zeugt eine Gedenktafel, die Wolfssäule bei Doberlug.
Doch der Wolf ist zurück. Heimlich ist er über die Oder gekommen. Seine Spuren führen nach Sachsen, nach Vorpommern und natürlich nach Brandenburg, wie nach Storkow. Schade nur. Der Wolf muss heute wie vor Jahrhunderten leiden: Allein von 1982 bis heute starben in Deutschland insgesamt mindestens 13 Wölfe durch Jägerhand. 1985 und 1986 wurden im Kreis Eberswalde zwei Wölfe geschossen. Ein Jahr später mußte ein Exemplar in Hagenow bei Berlin sein Leben lassen. Seit 1989 sind Wölfe streng geschützt. Auch deshalb drückte Detlef Bennewitz nicht ab, obwohl er seine Büchse auf dem Hochsitz dabei hatte. Er freute sich lieber über den einsamen grauen Rückkehrer.
|
(Quelle: Berliner Zeitung v. 25.1.2000)
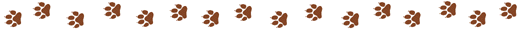
(Quelle: Sueddeutsche Zeitung v. 18.1.2000)
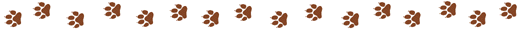
Die Daten bestätigen die Vermutung, die der wiederholte Auftritt von Wölfen in der Schweiz in den letzten Jahren nahe legt: Die Art hat sich in den Südalpen schon stärker etabliert, als man bisher geglaubt hat. Der italienische Wolfsforscher Luigi Boitani schätzt, dass die zehn Rudel gesamthaft um die 50 Tiere zählen und jedes Jahr 10 Jungwölfe abwandern. Die Einwanderungen in die Schweiz werden somit in den kommenden Jahren wahrscheinlich zunehmen. (hjb)
(Quelle: Schweizer Tagesanzeiger v. 6.1.2000)
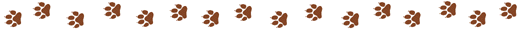
Die Suche nach dem Wolf beginnt sofort. Im Zentrum steht der Einsatz eines Helikopters. Das Tier soll aus dem Unterholz gelockt, mit einem Netz gefangen und mit einer Spritze betäubt werden. Endgültig zum Abschuss frei gegeben wird der Wolf erst, wenn er noch zweimal zuschlägt und dabei 14 Schafe tötet, was einem durchschnittlichen Wolfsangriff entspricht. Der Wolf hält sich laut Fachleuten zurzeit als einziger im Wallis auf. Der World Wide Fund of Nature (WWF) kritisierte den Plan. Auch der Tod dieses Wolfes werde Artgenossen nicht daran hindern, sich an unbewachte Schafherden heranzumachen, die noch im November auf 2.000 Metern Höhe weideten.
Wölfe erregen die Gemüter der Schafzüchter im Wallis seit 1995, als sie im Val Ferret erstmals auftauchten. Eines der Tiere war bei einer Treibjagd verletzt worden. Ein anderer Wolf tauchte 1998 im Vallee de Conches auf und wurde von Unbekannten erlegt. Ein drittes Exemplar wurde Anfang dieses Jahres auf dem Simplonpass von einem Schneepflug zu Tode gefahren, bevor sich im Sommer an verschiedenen Orten erneut ein Wolf bemerkbar machte.
(Quelle AP v. 17.12.1999)
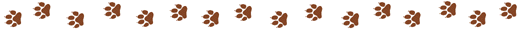
Ganzjährig geschont
Anders ist die Situation beim Wolf. In Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg wurden seit 1984 immerhin 13 Wölfe getötet, der letzte am 9. Januar 1999 im Uecker-Randow-Kreis. Ein Jagdgast hatte auf ihn geschossen, obwohl für Wölfe ganzjährig Schonzeit gilt. Der Abschuss war somit illegal.
Im Müritz-Nationalpark wurde 1995 bei Zartwitzer Hütte und Amalienhof mehrmals ein wolfsähnliches Tier gesehen. Verwechslungen mit Schäferhunden oder Huskies können aber möglich sein. Die Tendenz zeigt jedoch, dass der Wolf im Gegensatz zum Luchs in der Lage ist, weite Wanderungen zu unternehmen und längst verlassene Lebensräume wiederbesiedeln kann. Die Theorie der "alten Wolfspfade", wonach die Tiere seit Jahrhunderten die gleichen Wege benutzen, scheint in jüngster Vergangenheit an Aktualität zu gewinnen. Eine künstliche Wiederansiedlung von Wolf und Luchs kommt im Müritz-Nationalpark deshalb nicht in Frage. Die natürliche Einwanderung des standorttreuen Luchses ist durch die große Entfernung zur nächsten Population nahezu ausgeschlossen. Die Art erweitert ihren Lebensraum nur langsam.
Könnten Wolf und Luchs im Müritz-Nationalpark heimisch werden? Um die Frage zu klären, müssen zunächst Biologie und Lebensraumansprüche der beiden Raubtierarten betrachtet werden.
Der Luchs wird etwa 30 bis 45 Kilo schwer. Sein Beutespektrum reicht von der Maus über den Fuchs bis zum geringen Rothirsch. Er ernährt sich aber auch von Fallwild. Die Schalenwildbestände (Rot- und Damhirsch, Wildschwein, Mufflon und Reh) im Müritz-Nationalpark würden als Nahrungsgrundlage völlig ausreichen, um mehrere Luchse zu ernähren. Da die Großkatzen bevorzugt Kitze und Kälber bzw. kranke und überalterte Tiere erbeuten, könnte ihr Einfluss auf das Schalenwild sogar günstig sein. Die Schalenwilddichte wird durch ihn aber nicht reguliert.
Experten gehen davon aus, dass der Luchs eine Reviergröße von 10 000 bis 20 000 Hektar benötigt. Im 32 000 Hektar großen Müritz-Nationalpark könnten somit bestenfalls drei Luchse Lebensraum finden. Eine gesunde, sich selbst erhaltende Population müsste jedoch aus etwa 100 Tieren bestehen, denn eine Inselpopulation von nur wenigen Individuen ist auf Dauer nicht lebensfähig.
Beim Wolf stellen sich die Verhältnisse ähnlich dar. Die Schalenwilddichte würde mit Sicherheit ausreichen, um einen geringen Wolfsbestand zu ernähren. Doch auch der Wolf benötigt riesige Jagdgebiete, die ihm der Müritz-Nationalpark allein nicht bieten kann.
Bei beiden Großraubtierarten kommt hinzu, dass die Bevölkerung ihnen nach wie vor skeptisch gegenüber steht. Die beiden könnten in der deutschen Kulturlandschaft nur überleben, wenn die Menschen bereit wären, ihren Siedlungsraum mit ihnen zu teilen.
Beide Arten geschützt
Der Wolf hingegen legt auf der Suche nach neuen Gefilden weite Strecken zurück. Der Anspruch an die Lebensraumgröße ist jedoch zu hoch, als dass er in der Region des Müritz-Nationalparkes heimisch werden könnte.
Sollten aber wider Erwarten beide Raubtierarten von selbst den Nationalpark besiedeln, wird das Nationalparkamt ihnen keine Steine in den Weg rollen. Wolf und Luchs sind durch Artenschutz-, Naturschutz- und Jagdrecht ganzjährig streng geschützt und dürfen weder erlegt oder beunruhigt noch anderweitig gestört werden. Der Hinweis sollte beachtet werden.
(Quelle Nordkurier v. 14.12.1999)
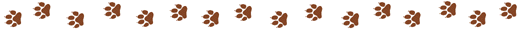
Angst vor dem "bösen Wolf"
Französische Schafzüchter machen Jagd auf das aus Italien eingewanderte Raubtier
Der Vorsitzende des Schafzüchterverbandes des Mercantour-Berglandes hinter Nizza, Bruno Bernard, hat weitere "Wolfsjagden" angekündigt. "Wir haben mehr als genug und nichts mehr zu verlieren", sagte er. "Die meisten von uns haben nicht einmal einen Jagdschein, aber das ist uns egal." Sein Mitstreiter René Donadey drohte sogar mit "systematischer Vergiftung" der Wölfe. Auslöser der zornigen Protestaktion war der Tod von 357 Schafen, die eine Woche zuvor auf der Flucht vor Wölfen in eine Schlucht gestürzt waren. Nach offiziellen Zahlen wurden im vergangenen Jahr 1250 Schafe im Mercantour-Gebiet und in den französischen Alpen von Wölfen getötet. Dafür gibt es zwar staatliche Entschädigungen, die den Züchterverbänden zufolge aber zum einen nicht ausreichend sind und zum anderen das Problem nicht lösen. Wölfe tauchten erstmals seit mehr als drei Jahrzehnten im Winter 1992/93 wieder in Frankreich auf. Sie gelangten von Italien über die Grenze und sorgen seither für Ärger.
In den Bergen hinter der Côte d'Azur gibt es nach den amtlichen Zahlen etwa ein Dutzend Wölfe, doch den Züchtern zufolge sind es drei- bis vier Mal mehr. Schützenhilfe bekamen die aufgebrachten Schafshalter im Oktober von einer Studiengruppe der Nationalversammlung. Die Abgeordneten kamen zu dem Schluss, der Schutz der Wölfe gemäß einem internationalen Abkommen von 1979 und einer EU-Richtlinie von 1992 sei unvereinbar mit der Schafzucht in den Bergen.
In dem Gutachten wurde unter
anderem die Schaffung von Wolfsreservaten im Mercantour-Gebiet und in den Alpen
vorgeschlagen sowie nahe gelegt, Ausnahmen von den internationalen
Schutzbestimmungen zu machen. "Heute ist in der Bergwelt nicht mehr der
Wolf, sondern der Mensch vom Aussterben bedroht, wenn ihm sein Leben dort
vergällt wird", gab der Abgeordnete Daniel Chevallier von der
sozialistischen Regierungspartei zu bedenken. Doch die Grünen von
Umweltministerin Dominique Voynet wiesen die Empfehlungen der Studiengruppe
entschieden zurück. Es sei unannehmbar, die Wölfe in Tierschutzparks
einzusperren oder gar auszulöschen, sagte einer ihrer Abgeordneten, Guy
Hascoët. Angebracht sei dagegen staatliche Hilfe, damit die
französischen Schafshalter ihre Herden wie im benachbarten Italien durch
speziell dressierte Hunde und nachts durch eingezäunte Koppel
schützen könnten. Die Organisation Frankreich-Natur-Umwelt
verurteilte das Gutachten als "Zeugnis für mangelhafte
Sachkenntnis". Empört reagierte auch die Tierschutzstiftung der
ehemaligen Filmschauspielerin Brigitte Bardot.
(Quelle Saarbrücker Zeitung v. 6.12.1999)
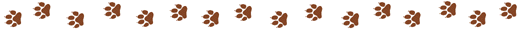
Seit Kriegsende vor vier Jahren hat die Zahl der Raubtiere in Bosnien erheblich zugenommen, Meldungen über gerissenes Vieh häufen sich. Mit Hilfe zahlungskräftiger ausländischer Jäger wollen die Jagdgesellschaften den Wolfsbestand reduzieren.
RAIMUND WEIBLE
Der 1980 gestorbene Staatspräsident machte Bugojno zum berühmtesten Jagdrevier von ganz Jugoslawien. Mit seinen Jagdkameraden legte der Präsident im Radusa-Gebirge auf exotische Tiere an: Schwarzbären und Wölfe. Auch zahlende Jagdtouristen durften vor dem Krieg Bären und Wölfe schießen.
Jetzt, vier Jahre nach dem Bosnien-Krieg, wünschen die einheimischen Jagdgesellschaften, dass die Jagdtouristen wieder ins Land kommen. Mustafa Bastic, Direktor der Jagdgesellschaft von Bugojno, umwarb dieses Jahr bereits auf der Leipziger Messe ausländische Jagdveranstalter. Mit 2000 Mark sind sie die Gäste dabei. So viel kostet der Abschuss eines einjährigen Wolfs. Für ein zweijähriges Tier berechnet Bastic doppelt so viel. Doch ob die Reklame Erfolg hat, ist zweifelhaft. Berichte über verminte Wälder schrecken Touristen ab.
In den Bergwäldern von Bugojno wurden vor dem bosnischen Krieg gerade fünf bis sechs Wölfe pro Jahr geschossen. ¸¸Damals war ein Wolfsjäger noch ein richtiger Jäger'' sagt Ismet Zeceviz, der stellvertretende Direktor des Forstbetriebs von Bugojno. Inzwischen ist der Abschuss der Wölfe keine Seltenheit mehr. Sie haben sich enorm vermehrt. Und seitdem jedes Jahr 40 Wölfe zur Strecke gebracht werden, haben die Wolfsjäger ihre Ausnahmestellung verloren. Zeceviz fast verächtlich: ¸¸In jedem Dorf gibt es einen.'' Die bosnischen Förster sehen die Zunahme der Wölfe zum einen als Folge einer Wanderbewegung der Tiere von Russland in Richtung Balkan. Doch der Hauptgrund sind die zerstörten Bergdörfer in Bosnien. Ganze Landstriche wurden durch den Krieg entvölkert. Ein Vakuum entstand, das die Wölfe in kurzer Zeit füllten.
Sie vermehrten sich rasch, weil ihre Ernährungssituation günstig ist. Auch eine Folge des Krieges. Die Flüchtlinge ließen viele Haustiere zurück. Verwilderte Kaninchen und anderes Kleinvieh sind eine leichte Beute für die Wölfe. Darauf beschränken sich die Wölfe selbstverständlich nicht. Meldungen über gerissene Schafe häufen sich. ¸¸Jedes Dorf ist betroffen'', sagt Zeceviz.
Geklagt über den Wolf wird auch im Konjuh, dem Mittelgebirge 50 Kilometer nördlich von Sarajevo. Der Forstbetrieb Miljevica verfügt zwar im Konjuh über das Jagdmonopol. Aber inzwischen nahmen die Schadensfälle derart zu, dass Reuf Avdibasic, der Chef des Forstbetriebs, nichts dagegen hat, wenn die Bauern am Rande ihrer Siedlungen zur Selbsthilfe greifen. ¸¸Es würde genügen, wenn es hier drei Wölfe gäbe'' sagt Avdibasic, ¸¸zwölf Tiere sind einfach zu viel.'' Im vergangenen Jahr hat ein einziger Wolf an einem Tag gleich zwanzig Schafe gerissen - ein herber Verlust für einen Hirten, der unter schwierigen Umständen dabei ist, seine Herde aufzubauen.
Selbst im Bjeslavica-Gebirgszug bei Sarajevo, wo sich die Skiabfahrt und die Sprungschanzen der Olympischen Spiele von 1984 befinden, hat zur Freude der Tierschützer und zum Ärger der Hirten der Wolf wieder Fuß gefasst.
Budinpotok Palez, beim Forstbetrieb Miljevica verantwortlich für die Baumschulen und die Jagd, führt uns zu einer Jagdkanzel am Schwarzen Fluss. Auf dem Platz davor sind Maiskörner ausgestreut, um Wildschweine anzulocken. Der Boden ist über und über mit ihren Spuren bedeckt. Eine Wolfsspur ist keine zu entdecken. ¸¸Der Wolf kommt, ohne Spuren zu hinterlassen'' erläutert Palez, ¸¸er schleicht sich über den Bach an.''Aber da - ein riesiger Abdruck im Boden. Keine Frage - ihn hat ein Bär hinterlassen.
(Quelle Südwestpresse v. 20.11.1999)
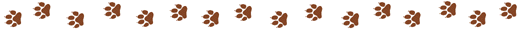
Scheue Wölfe, aggressive Hunde
Menschen fürchten die Rückkehr des wilden
Isegrim,
doch zahme Vierbeiner richten weitaus mehr Schaden
an
Der Wolf hat, ob er nun Rotkäppchen respektive die sieben Geißlein verspeist oder im Horrorfilm als Werwolf in Erscheinung tritt, einen festen Platz in der Mythologie des Bösen. Versuche, dieses in Europa vom Aussterben bedrohte Raubtier wieder einzubürgern, oder wenigstens dort, wo er sich von selbst einfindet, nicht erneut auszurotten, werden von Teilen der Öffentlichkeit daher misstrauisch beäugt. Eine Umfrage der Gesellschaft zum Schutz der Wölfe ergab: Gut die Hälfte der Interviewten unter 40 Jahren befürwortete zwar, dass Wölfe in Deutschland unter Schutz stehen. Ältere sind noch skeptischer. Mehr als 40 Prozent aller Befragten fürchten jedoch, die Untiere könnten bei einem Waldspaziergang ihren Kindern gefährlich werden.
Der domestizierte Nachfahre des Wolfes dagegen gilt, ob nun Schoß- oder Schutzhund, als des Menschen bester Freund. „Tatsächlich werden aber weltweit sehr viel mehr Menschen durch Hunde angegriffen und verletzt als durch ihre wilden Vorfahren“, so der Hundetrainer Günther Bloch kürzlich auf dem ersten internationalen Symposium über Caniden – also hundeartige Raubtiere – in Bergisch-Gladbach. Bloch berichtete über ein „erschreckend hohes Aggressionspotential“ vieler Hunde. Von 510 Haushalten mit Hund habe es in 382 Fällen Probleme durch angriffslustiges Verhalten des Tieres gegeben, fasst Bloch eine Umfrage unter Kollegen zusammen.
Allein etwa 3500 Briefträger werden jährlich von Hunden gebissen. Kommunikationsprobleme zwischen Herrchen oder Frauchen und dem geliebten, aber oft nicht verstandenen Vierbeiner, mangelnde Auslastung der Tiere sowie völlig unangemessene Privilegien der Hunde im Haushalt nannte Bloch als Ursachen für Aggressionen. Nicht selten führe das unakzeptable Verhalten des Hundes den Besitzer in die soziale Isolation. „Und dieser meint dann noch, die fernbleibenden Bekannten und Verwandten seien Schuld, weil sie eben nichts von Hunden verstünden.“
Wie sich Hunde mit Menschen und untereinander verständigen, untersuchte Dorit Feddersen-Petersen von der Universität Kiel. Sie ging der Frage nach, ob Bellen eine eher unspezifische Lautäußerung ist, die allgemein Aufgeregtheit widerspiegelt oder ein differenzierteres Kommunikationsmittel. Die Verhaltensforscherin maß Frequenz und Amplitude des Gebells und fand, je nach Rasse, zwei bis acht unterschiedliche Laute, die sich Situationen wie Spiel, Erkundung, Fürsorge oder Begrüßung zuordnen lassen. Wölfe zeigen viele dieser Laute nur im Welpenalter. Die erwachsenen Wölfe, so Feddersen-Petersen, verständigen sich vorwiegend durch Körpersprache und Mimik. Diese aber sei bei vielen Hunderassen stark eingeschränkt: Eine zusammengedrückte Schnauze, Hängeohren oder eine stets in kummervolle Falten gelegte Stirn machten viele wolfstypische Signale unmöglich. Manche Hunderassen könnten daher kein funktionierendes Sozialleben in Gruppen entwickeln. Denn das Bellen ersetze die verlorene Zeichensprache zwischen Artgenossen nicht. Was von manchem nur als lästige Kläfferei empfunden werde, diene vor allem der Zwiesprache mit dem Menschen.
Mit Verständigung zwischen Herrn und Hund steht es dennoch nicht immer zum Besten. Wo der Vierbeiner sich vom Arbeitsgefährten zum Gesellschafter wandelt, wachsen die emotionalen Erwartungen an das Tier. „Das führt dazu, dass Tiere es immer schwerer haben, ihr Leben mit dem Menschen zu teilen“, glaubt Peter Neville vom britischen Verband der Verhaltenstherapeuten für Haustiere. Nervosität, Trennungsängste und Aggressivität der Tiere nähmen zu und seien oft nur mit Hilfe von Verhaltenstherapie und Psychopharmaka zu bewältigen.
Die Behauptung, die meisten Leute kämen gut zurecht mit ihren Hunden, stimme einfach nicht, meint auch Günter Bloch. Nicht selten seien nicht die Hunde, sondern die Hundehalter therapiebedürftig. Und „mindestens 50 Prozent der Hunde passen nicht zu den Menschen, die sie haben.“ Wer sich etwa einen der gerade modernen großen Hirtenhunde zulege, rechne oft nicht mit dessen ausgeprägtem Territorialverhalten.
Denn nicht für die Etagenwohnung oder zur Verschönerung des Vorgartens wurden diese Rassen gezüchtet. Sie schützten Viehherden vor Raubtieren. Anders als Hütehunde, die die Herden gemeinsam mit dem Hirten lenken, leben die Schutzhunde vom Welpenalter an ständig mit den Schafen zusammen und verteidigen die Herde. Könnten sie sich darüber Gedanken machen, hielten sie sich womöglich selber für Schafe. Vielerorts verzichteten die Viehhirten mit dem Rückgang der Wölfe auf die massigen Schutzhunde. Doch seit Wölfe nicht mehr geschossen, vergiftet oder in Fallen gefangen werden dürfen, nehmen in extensiv gehaltenen Schaf- oder Ziegenherden die Verluste zu.
Daher bemühen sich neuerdings Ökologen, die alten Schutzhundrassen bei Viehhaltern wieder populär zu machen. So gibt in Portugal das Nationale Institut für landwirtschaftliche Forschung Welpen von Herdenschutzhunden an Hirten ab. Das Projekt, über das der Ökologe Fernando Petrucci-Fonseca von der Universität Lissabon berichtete, verfolgt zwei Ziele: Es soll den gesetzlichen Schutz der vom Aussterben bedrohten Wölfe für Viehzüchter akzeptabel machen. Gleichzeitig werden so auch traditionelle Hunderassen, wie der Cao da Serra da Estrela oder der Rafeiro do Alentejo erhalten.
Ob und in welcher Zahl in Deutschland Wölfe wild leben, ist unklar, so der im Bayerischen Wald mit Wölfen arbeitende Erik Zimen. Denn die Tiere sind ausgesprochen scheu. Undenkbar, dass Wölfe hier zu Lande unmittelbar im Umkreis menschlicher Siedlungen vorkommen und bei der Nahrungssuche urbane Gebiete durchstreifen, wie es Ovidiu Ionescu aus dem rumänischen Brasov berichtete. Nur als Grenzgänger aus Tschechien oder Polen sind Wölfe in der Bundesrepublik eindeutig nachgewiesen. Doch Jäger schätzen die Konkurrenten nicht. Und so wird etwa ein im Grenzgebiet zu Polen auftauchender Wolf schon mal „aus Versehen“ erschossen.
In Westpolen, wo er bereits ausgestorben war, ist Isegrim inzwischen wieder heimisch geworden. In den 50er Jahren gab es in ganz Polen weniger als 100 Wölfe, legte Henryk Okarma von der Universität Krakau dar. Erst 1997 wurde das seltene Raubtier dort völlig unter Schutz gestellt. Doch illegale Jagd und Viruserkrankungen halten die Zahl der Tiere weiterhin gering. In Schweden wo seit den 80er Jahren auch im Süden des Landes wieder Wölfe leben, wächst die Population ebenfalls nur langsam, berichtete Björn Ljunggren von der Swedish Carnivore Association.
Ein Hauptproblem sind genetische Schäden durch
Inzucht. Der österreichische Genetiker Hellmuth
Wachtel widersprach in seinem Vortrag der Annahme,
Paarungen unter nahen Verwandten seien bei Wölfen
ohnehin üblich und daher nicht Besorgnis erregend.
Genetische Analysen zeigten, dass unter natürlichen
Bedingungen die Alpha-Paare, also die Leittiere, meist
nicht verwandt sind. Doch bei zu kleinen Gruppen und
zerstückelten Lebensräumen finden Wölfe nur
noch schwer fremde Partner. Studien in Zoos ergaben, dass
die Tiere nach mehreren Inzucht-Generationen unter ernsten
genetischen Störungen leiden. Das könnte die
hohen Verluste durch Krankheiten erklären, da durch
Defekte im Erbgut die Abwehrkräfte sinken. Der Urahne
aller bellenden Vierbeiner bleibt also gefährdet
– und weit weniger gefährlich als seine
domestizierten Nachfahren.
Von Matthias Schröter, dpa
Um den Wolf wieder heimisch zu machen, müsse man beispielsweise
an Schäfer Kompensationszahlungen für gerissene Schafe und Lämmer
leisten. «Sonst kocht die Seele hoch», meint Bloch. Wölfe
leisten nach seiner Ansicht der Natur einen besseren Dienst als die Jäger.
Die Tiere könnten den Bestand an Rehen, Wildschweinen oder Hirschen
besser kontrollieren. «Jäger sind Trophäensammler»,
sagt Bloch. Die Wölfe hingegen rissen vor allem schwache, kranke
und alte Tiere. Der Wolf gehöre zur mitteleuropäischen Tierwelt
und sei ein Kulturgut.
Inzwischen habe sich durch Filme wie «Der mit dem Wolf tanzt»
(Kevin Kostner) die Akzeptanz des Raubtieres auch in der deutschen Gesellschaft
verbessert. Nach intensiven Schutzbemühungen habe sich der Bestand
in den vergangenen 20 Jahren in Europa wieder auf mehr als 20 000 Exemplare
erholt, berichtet Bloch. Der weitaus größte Teil der Tiere
lebe in Spanien und Russland. In Deutschland - hier war der Wolf 150 Jahre
lang ausgestorben - sei die Zahl der Tiere in den vergangenen acht Jahren
auf rund 20 angestiegen. Hin und wieder sei auch vor der Wende ein «Grenzgänger»
von Polen in die DDR gewandert. Dort seien die Tiere aus Angst vor Tollwut
abgeschossen worden.
Die Wolfs-Gesellschaft veranstaltet vom 28. bis zum 31. Oktober in Bergisch
Gladbach bei Köln ein internationales Symposium zum Thema Caniden
- also zu allen hundeartigen Tieren wie Wolf, Hund, Schakal, Kojote und
Fuchs. Es ist nach Angaben der Veranstalter der erste Kongress dieser
Art in Deutschland. «Mit dem Kongress, an dem 20 namhafte Referenten
aus aller Welt teilnehmen, wollen wir auf den Wolf in Deutschland aufmerksam
machen», sagt Bloch.
Die Tiere seien für Menschen völlig ungefährlich, vor
allem «weil sie so scheu sind». Deshalb werden die Wölfe
auch so selten gesehen. Dass Meister Isegrim überhaupt gelegentlich
in Deutschland streunt, lässt sich meist nur an Pfotenabdrücken,
Kot oder gerissenen Wildtieren ablesen.
Hauptsächlich wandert der Wolf laut Bloch durch die Gebiete an
Oder und Neisse, seltener tauchen Spuren der Tiere in Bayerischen Wald
auf. Die Wölfe kommen aus Polen und Tschechien. In Polen leben nach
Angaben der Wolfs-Gesellschaft rund 600 Tiere, auf dem Gebiet der ehemaligen
Tschechoslowakei rund 4 000. Der hohe Wildbestand in Deutschland biete
Wölfen eine gute Nahrungsgrundlage, meint Bloch.
(Quelle: Rhein-Neckar-Zeitung v. 28.10.1999)
Die Erziehung erfolgt gewaltfrei
Die Teilnehmer sahen Neumann bei der Fütterung der Wölfe zu und erfuhren in einer Diaschau von der Entstehung der Wolfsschule und Wolfsdressur. Abgerundet wurde der Abend durch Sagen über "die Grauen" und Führungen zum Wolfsgehege bei Vollmond. Neu an der Konzeption dieses Angebots sei, dass man versucht habe, Interessierte nicht nur durch Informationen, sondern auch über Emotionen an das Thema Wölfe heranzuführen, so Neumann.
Seine Absicht, sei es zu zeigen, dass Menschen sich mit Tieren anfreunden könnten. Das bedeute aber nicht, sie auch zu beherrschen, betonte der Direktor. Im Tierpark solle für junge und ältere Zuschauer der Spaß am Zuschauen vermittelt werden. Wölfe eigneten sich für diese Begegnungen gut.
In der Wolfsschule werden derzeit sechs Vierjährige von Neumann unterrichtet. Diese Dressur sei nur möglich, weil er die Tiere in ihren ersten Lebenswochen bekommen und mit der Flasche groß gezogen habe, erläuterte der Direktor, der auch Fachtierarzt für Zoo- und Wildtiere ist. Die Erziehung der Wölfe erfolge gewaltfrei.
Das angeborene Mißtrauen dieser Wildtiere zu überwinden, sei der schwierigste Teil des intensiven und mühsamen Lernprogramms, dem er bereits die Jungtiere unterziehe, beschrieb Neumann. Dieser Abbau der natürlichen Scheu sei die Voraussetzung, um überhaupt weiterhin mit ihnen umgehen zu können. Besonders wichtig für Vorführungen im Tierpark sei außerdem, dass die Wölfe auch zu Fremden Vertauen gewinnen.
"Nur der wirkliche Tiermensch kann fühlen, wieviel mehr Wildheit im Wolf brodelt als beispielsweise im Hund", beschrieb Neumann den Zugang zu seinen "Schülern". Er werde durch die Beschäftigung mit ihnen für die Wölfe zwar zur Vertrauens- und Respektsperson, dennoch werde er nicht als zum Rudel gehörig anerkannt. Wölfe blieben auch im Tierpark Wildtiere, handelten instinktgebunden und zeigten keine extreme Form der Zuneigung wie Hunde. Allerdings gebe es Übergangsformen im Verhalten von besonders toleranten und zutraulichen Ausnahmetieren, die dafür allerdings von ranghöheren Tieren im Rudel gemaßregelt würden. Da selbst innerhalb einer Geschwistergruppe die Talente sehr unterschiedlich verteilt seien, sei es seine Aufgabe, die Wölfe gemäß dieser Individualität auszubilden, so der Direktor. Wölfe lernten sehr schnell - sie seien regelrecht "obereifrige Schüler" und begrüßten das Lernprogramm als willkommene Aktivität. Erzogen werde anhand von Stimme, Mimik und Gestik sowie Belohnungen bis Wölfe automatisch auf geringe Hilfen reagierten. Neumann begann vor fünfzehn Jahren mit der Wolfsdressur. Seit 1995 leitet er den Tierpark und bietet Besuchern tägliche Vorführungen mit den Stammvätern aller Hunderassen als Höhepunkt ihres Besuches an.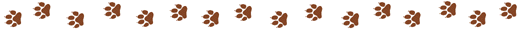
Wolfsschützer sehen Platz
für etwa 200 Wölfe in Deutschland Köln
(dpa) - Tausende von grauen Wölfen heulen durch Europa: Und auch
in Deutschland soll das Raubtier wieder heimisch werden. Dafür tritt
die Gesellschaft zum Schutz der Wölfe e.V. (Bad Münstereifel)
ein. Günther Bloch, Geschäftsführer der Gesellschaft, will
erreichen, dass immer mehr Tiere nach Deutschland einwandern. An Oder
und Neisse und im Bayerischen Wald sei Platz für viele Rudel. Rund
200 Tiere könnten in den nächsten Jahren Lebensraum in der Bundesrepublik
finden.
Köln
(dpa) - Tausende von grauen Wölfen heulen durch Europa: Und auch
in Deutschland soll das Raubtier wieder heimisch werden. Dafür tritt
die Gesellschaft zum Schutz der Wölfe e.V. (Bad Münstereifel)
ein. Günther Bloch, Geschäftsführer der Gesellschaft, will
erreichen, dass immer mehr Tiere nach Deutschland einwandern. An Oder
und Neisse und im Bayerischen Wald sei Platz für viele Rudel. Rund
200 Tiere könnten in den nächsten Jahren Lebensraum in der Bundesrepublik
finden.